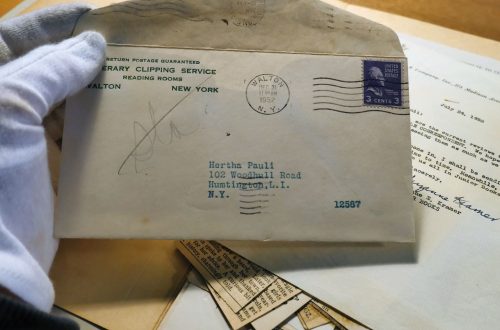Adults only
28. September 2025
Lisa Elsen
Aline Bouvy‘s Ausstellung „Hot Flashes“ im Casino Luxembourg – Forum d’art contemporain weitet den Blick für kindliche Perspektiven und erwachsene Erfahrungsräume und gibt einen Vorgeschmack auf die Biennale von Venedig im kommenden Jahr. Eine Kooperation mit dem Salzburger Kunstverein
„Die Kindheit nähert uns vielleicht am meisten dem ‚wahren Leben‘“[1], konstatierte André Breton 1924 in seinem Manifest des Surrealismus. Die Kindheit deklariert er zu einem Moment der Wahrhaftigkeit und Befreiung, das Erwachsenenleben wird in dieser Logik zu einem Korsett aus normierten Vorstellungen. Rund 100 Jahre nach Breton stößt dieses Thema innerhalb der Kunst nach wie vor auf Interesse, wie die Ausstellung Hot Flashes zeigt. Zu sehen ist diese noch bis zum 12. Oktober im Casino Luxembourg, entstanden in Zusammenarbeit mit dem Salzburger Kunstverein.
In ihrer Einzelausstellung widmet sich die belgisch-luxemburgische Multimediakünstlerin Aline Bouvy der Übergangsphase von der Kindheit zum Erwachsenenalter. Darauf verweist bereits der Titel: Hot Flashes spielt auf die heißen Schauer und Wallungen an, die sowohl bei Teenagern als auch bei Frauen auftreten – wenn auch in unterschiedlichen Ausprägungen und Phasen. Diesen Lebensetappen nähert sich Bouvy, die Luxemburg im kommenden Jahr bei der Biennale von Venedig vertreten wird, mittels großformatiger Arbeiten und Verweisen auf die Populärkultur an. Den Körper rückt sie als Verhandlungsmasse gesellschaftlicher Wertvorstellungen ins Zentrum: Wie spiegeln sich die Blicke von außen in unserer Selbstwahrnehmung wider und wie nehmen wir andere Körper wahr? Dem geht Bouvy in ihrer Ausstellung auf besondere Weise nach, indem sie Spielräume für entrückte Körper und verzerrte Wahrnehmungen schafft; eine Einladung, Gewohntes über Bord zu werfen.
Same but different
Den Auftakt ihrer Ausstellung bildet eine Hommage an die Serie The Same Room der Künstlerin Julie Becker (1972–2016). In den 90er-Jahren hat Becker unter anderem Kinder- und Jugendzimmer maßstabsgetreu nachgebaut und mit Blick auf Dekor und Farben angepasst. Ziel: Die Schattenseiten solcher Räume offenlegen; Traumata und das Aufwachsen in prekären Verhältnissen thematisieren. Daran schließt Bouvy an, reinszeniert mit dem Acrylwandgemälde The Same Room (after Julie Becker) (2025) die Fotoserie der US-Künstlerin: Poppig, pastellig, und vor allem grotesk in seiner Überdimensionierung. Die Proportionen wirken unnatürlich, die Figuren verfremdet und verniedlicht.
Das Interesse für kindliche Räume bleibt bei der belgisch-luxemburgischen Künstlerin bestehen. Allerdings setzt sie einen anderen Schwerpunkt, indem sie Fragen von Heteronormativität und Macht in den Fokus rückt: Wer wird zur betrachtenden Person, wer zum Objekt und inwiefern ist das mit einer (früh)kindlichen Prägung verknüpft? Der deep dive in die eigene Kindheit wird für die Besucher:innen zu einem Muss, Unbehagen und Unordnung werden zu immanenten Gefühlen. Bouvy setzt solche Störmomente bewusst ein: Durch das Spiel mit unterschiedlichen Maßstäben und visuellen Verzerrungen wird die eigene Wahrnehmung ebenso infrage gestellt wie klassische Schönheitsideale und Körperbilder. Dieses Ziel verfolgt die Multimediakünstlerin auch mit den Werken Wall und E.T. The Excremential.
Vom anderen Stern
Eine wellenförmige Wand aus Einwegspiegeln. Davor: ein Außerirdischer mit ausgestreckter Hand. Die großformatige Installation Wall teilt den Großen Saal des Kulturforums. Durch die Zweiteilung wirkt der Raum in sich geschlossen und eröffnet die Möglichkeit eines erweiterten Blickfeldes. Wall – angelehnt an die verspiegelten Pavillons von Dan Graham (1942–2022) – lotet damit die Grenzen aus, die Architektur und Optik vorgeben. Als Besucher:in wird man zum Spiegelbild der eigenen Wahrnehmung; asymmetrisch und verzerrt. Der menschliche Körper wird in dem Kontext zum eigentlichen Medium, an dem sich Fragen von Identität und Tabuisierung verhandeln lassen. Damit geht ein Perspektivwechsel einher, der am Körper von E.T. erkennbar wird. Dieser nimmt eine niedrigere Position im Raum ein. Zwar ähnelt der Körper dem eines Greises, die Perspektive aber der eines Kindes. Das regt dazu an, einen anderen Blickwinkel einzunehmen, während einem die eigene Andersartigkeit vor Augen geführt wird. Erzählungen von Körpern außerhalb der westlich-europäischen Norm werden ins Blickfeld gerückt und aufgebrochen. Das Gleiche gilt für die Skulptur und Soundinstallation Cherub Dub.
(K)ein Himmel auf Erden
Bouvy verhandelt mit ihrer Küchennachbildung Cherub Dub den Status der Frau innerhalb der Gesellschaft, indem sie den häuslich-familiären Raum einem Bedeutungswandel unterzieht: Für Kinder kann er ein Hort der Geborgenheit sein, im Kontext von Hot Flashes wird er hingegen zu einem Symbol für die fehlende soziale Mobilität der Frau. Die kindliche Perspektive weicht dem Erfahrungsraum des Erwachsenenalters, das Ur-Bedürfnis nach Sicherheit einem Gefühl der Beengtheit. Patriarchale Machtstrukturen legt Bouvy offen, das Innere kehrt sie nach außen. Letzteres findet seine Entsprechung in der roten Verglasung der Installation: Durch die Transparenz der Glasfronten werden Einblicke in das Innere der Küchenschränke gegeben, die unter anderem mit einem Kinderhochbett, Porzellan-Kanonen und einer Festung im Miniaturformat ausstaffiert sind. Der Festungsbau spielt in seiner Metaphorik auf den Zustand des Eingesperrtseins der Frau an, die weiteren Gegenstände werden durch ihre Miniaturisierung in eine kindliche Spielewelt eingebettet – einhergehend mit der unterschwelligen Kritik an der Infantilisierung erwachsener Frauen.
Die rote Verglasung hebt sich zudem farblich von der weißen Holzvertäfelung der Schränke und der Gegenstände ab. Rot steht hier für den inneren Furor, weiß gilt in der westlichen Welt als Symbol für Unschuld, Reinheit und Jungfräulichkeit und kann als Sinnbild für ebenjene Eigenschaften verstanden werden, die Frauen zugeschrieben werden. Die Farben geben stille Codes, mit denen die Position der Frau definiert wird.
Hot Flashes fordert dazu auf, die gesellschaftliche Ordnung zu hinterfragen, indem die Werke mit dem eigenen Körper in Dialog treten und ihn anregen, sich von rigiden Rollenbildern zu lösen. Bouvy führt diese Erwachsenen-Konventionen ad absurdum und kommt der Utopie eines wahren, kindlichen Lebens nach Breton ein Stück näher.
Fußnoten
[1] André Breton, Manifest des Surrealismus, in: Charles Harrisson / Paul Wood, Kunsttheorie im 20. Jahrhundert, Verlag Gerd Hatje, Ostfildern-Ruit, 1998, S. 549.
bis 12. Oktober 2025
Hot Flashes
Aline Bouvy
Kuratiert von Stilbé Schroeder
Montag, Mittwoch, Freitag, Samstag, Sonntag
11–19 Uhr
Donnerstag
11–21 Uhr


Das könnte dich ebenfalls interessieren
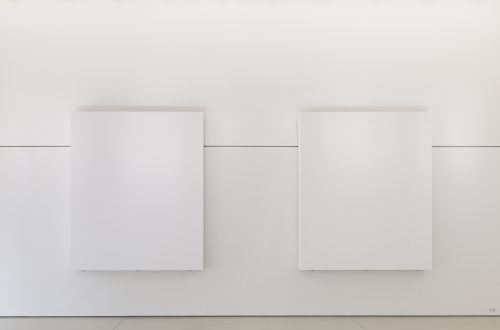
800 Kilos of Emptiness
September 24, 2025
Elfriede Mejchar küsst Baudelaire zum Lunch
Juli 15, 2024